Erbgut-Anomalien sicherer aufdecken
Gyn-Depesche 3/2015
Molekulargenetische Methoden bewähren sich
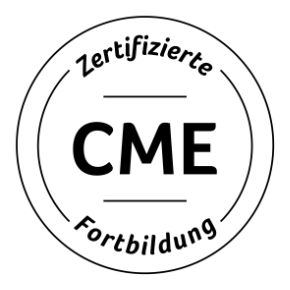
Viele Eltern wollen frühzeitig wissen, ob beim Nachwuchs mit einer genetisch bedingten Anomalie zu rechnen ist. Dabei sollte die Diagnostik so treffsicher und so wenig invasiv wie möglich sein. Moderne Methoden der Molekulargenetik werden solchen Ansprüchen weitgehend gerecht. Mit ihrem Einsatz auf breiter Ebene ist wohl bald zu rechnen.
Hinweis: Dieser Artikel ist Teil einer CME-Fortbildung.